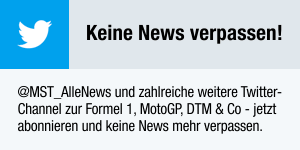Aoyama: "Ich bin bei 80 Prozent"
Hiroshi Aoyama nennt Gründe für den Schwund der japanischen Piloten in der Motorrad-WM - Der Gresini-Pilot will konstant in die Top 5 fahren
(Motorsport-Total.com) - Hiroshi Aoyama ist derzeit der einzige Japaner im MotoGP-Feld. Auch in den kleinen Klassen spielen seine Landsleute keine entscheidende Rolle. In den 1990er-Jahren wimmelte es nur so von Japanern, genau wie heute die Spanier stark vertreten sind. Der Gresini-Honda-Pilot gewann 2009 die letzte 250er-Weltmeisterschaft der Geschichte. Mit der Vorjahres-Honda kann Aoyama derzeit nicht mit den brandneuen Werksmaschinen mithalten, aber in den Top 10 kann er mitkämpfen.

© Honda
Hiroshi Aoyama kämpft mit der Vorjahresmaschine gegen die Konkurrenz
Worin liegen die Gründe, dass die Anzahl der japanischen Piloten stark zurückgegangen ist? "Das ist nicht so einfach. Die ökonomische Situation hat sich geändert. In der Vergangenheit konnte ein Pilot mit dem Geld eines Sponsors in die MotoGP gelangen", wird Aoyama von 'GPWeek' zitiert. "In den nationalen japanischen Meisterschaften gibt es keine Werksteams mehr. Früher konnte ein Fahrer von einem Privatteam, über eine Satellitenmannschaft in ein Werksteam aufsteigen. Es gab also eine Karriereleiter."
"Vor neun Jahren wurden die Werksengagements gestoppt. Damals fuhr ich in der japanischen Meisterschaft, aber ich hatte Glück, denn ich hatte zwei Rennjahre von der Honda-Schule erhalten. Es gibt immer noch Talent. Das Niveau ist vielleicht niedriger, aber einige junge Fahrer sind gut." Das hat auch mit den Regeländerungen in der MotoGP zu tun. Nach dem Aus der 500er-Maschinen werden die Viertakt-Prototypen ausschließlich in der Königsklasse eingesetzt.
Auch die Moto2 fährt nur in der spanischen Meisterschaft. Die Zeiten sind vorbei, in denen die Grand-Prix-Maschinen vergleichbar mit den Motorrädern in der japanischen Meisterschaft waren. 1996, 1997, 1998 und 1999 fuhr Daijiro Kato mit einer Wildcard in Suzuka in der 250er-Klasse. Zwei Siege und ein dritter Platz waren seine Ausbeute. Das zeigte, wie hoch das Niveau der japanischen Meisterschaften damals war.
Aoyama fuhr erst 2004, also ein Jahr nach dem tödlichen Unfall Katos, seine erste volle Grand-Prix-Saison. Von der 250er- stieg der 29-Jährige auf die MotoGP-Honda. Wie einfach fiel ihm der Umstieg rückblickend? "Der Fahrstil ist nicht so anders. Technisch muss man mehr lernen und verstehen. Im Vergleich zur 250er ist der MotoGP-Motor viel kräftiger."
"Deshalb muss man körperlich kräftiger sein. Abgesehen davon ist es im Großen und Ganzen das gleiche Motorrad. Es gibt aber viel Elektronik und manchmal vermittelt es dir ein seltsames Gefühl. Man spürt das Motorrad nicht. Man will mehr Power abrufen, aber es gibt dir nicht das, was du willst. In manchen Situationen denkst du dir, du bist auf dem richtigen Weg, aber das Motorrad folgt deinen Manövern nicht. Man spürt, wie die Elektronik arbeitet, und muss sich darauf einstellen."
Lernprozess dauert an
Noch hat Aoyama den Lernprozess nicht abgeschlossen. "Ich lerne immer noch. Das Team lernt auch noch, wie ich fahre und was ich brauche. Ich muss auch noch herausfinden, wie ich am besten fahre und mit dem neuen Team arbeiten muss. Ich würde sagen, dass ich derzeit bei 80 Prozent bin."
Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Marco Simoncelli muss Aoyama mit der 2010er-Honda auskommen. "Mein Motorrad ist aus dem Vorjahr, also ist es etwas anders als die aktuellen Werksmaschinen. Ich glaube, dass mein Paket nicht so schlecht ist. Über den Winter haben alle Hondas gut funktioniert, also habe ich ein konkurrenzfähiges Motorrad. Ich möchte in den Top 5 sein. Es gibt neun Werkspiloten, also kann ich in diesem Bereich sein. Das wäre ein gutes Resultat. Es ist nicht einfach, aber wenn man es für unmöglich hält, dann wird es unmöglich."
Die verheerende Naturkatastrophe in Japan hat auch Aoyama erschüttert. Zum Zeitpunkt des Tsunamis war er nicht in seiner Heimat. "Ich war am Flughafen in Barcelona und auf dem Weg zu den Testfahrten. Im Fernsehen sah ich die großen Wellen. Zuerst dachte ich, das sei ein Film. Dann war ich schockiert. Ich wollte meine Familie anrufen, aber es gab keine Verbindung."
"Einige Tage später fand ich heraus, dass meine Familie und Freunde okay waren. Wir leben 200 Kilometer von Fukushima entfernt. Ich war vergangene Woche für ein paar Tage in Japan. Es sieht alles normal aus. Alle machen sich aber Sorgen wegen der radioaktiven Strahlung. Man sieht sie nicht, fühlt und schmeckt sie nicht. Ich sah Kinder im Freien spielen. Die Leute gingen mit ihrem Hund spazieren. Es war alles sehr normal. Ich war überrascht. Es ist aber nicht so gut. Wir werden es in 20 Jahren sehen."