Monaco: Warum Teamplay jetzt eskaliert und früher kaum genutzt wurde
Die Formel 1 in Monaco hat sich radikal verändert: Warum Teams plötzlich keine Scheu mehr vor strategischer Manipulation haben und was die FIA jetzt tun muss
(Motorsport-Total.com) - Was sich beim Großen Preis von Monaco 2025 abspielte, hatte mit echtem Racing nur noch wenig zu tun. Statt Rad-an-Rad-Duellen prägte eine neue Dimension des Teamspiels das Geschehen - eine Taktik, bei der nicht nur einzelne Fahrer, sondern ganze Teile des Feldes bewusst eingebremst wurden, um strategische Vorteile zu erzwingen.

© circuitpics.de
Carlos Sainz war einer der Fahrer, der in Monaco die Bremse spielte Zoom
Gemeinsam mit unserem Technologiepartner PACETEQ haben wir einen Blick in die Daten geworfen und analysiert, warum ein derart extremes Maß an absichtlicher Verlangsamung in der Formel 1 bislang kaum zu beobachten war - und ob eine mögliche Delta-Zeit künftig Abhilfe schaffen könnte.
Lawson, Sainz, Albon: In die Punkte gebremst
Den Auftakt zum strategischen Schauspiel machte Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson. Der Neuseeländer, auf Rang neun liegend, begann nach dem Ende der virtuellen Safety-Car-Phase, das gesamte Mittelfeld auszubremsen. In den Runden fünf bis 18 war Teamkollege Isack Hadjar im Schnitt rund vier Sekunden pro Runde schneller unterwegs und konnte sich so gleich zwei Boxenstoppfenster herausfahren.
Auch das Williams-Team nutzte die Überholproblematik in Monaco konsequent aus und verlangsamte beide Fahrer teils drastisch - mit Rundenzeiten, die bis zu sechs Sekunden unter dem eigentlichen Tempo lagen. Der Höhepunkt: George Russell kassierte nach einem unerlaubten Überholmanöver gegen Alexander Albon eine Durchfahrtsstrafe - und kam dennoch wieder vor dem Williams-Piloten auf die Strecke zurück.
Extremes Teamplay: Warum erst jetzt, 2025?
Dass ausgerechnet die neue Zweistoppregel für dieses extreme Teamspiel verantwortlich sein soll, ist eher unwahrscheinlich. Theoretisch wäre es in der Vergangenheit sogar einfacher gewesen, über Teamtaktiken Positionen zu sichern, da bei Einstopprennen nur ein einziges Boxenstoppfenster nötig war. Und doch: Derart drastische Verlangsamungen hat man in den letzten Jahren kaum gesehen. Warum?
Ein oft genannter Grund sind die breiten und schweren Fahrzeuge der aktuellen Generation, die das ohnehin schwierige Überholen in Monaco noch weiter erschweren. Doch greift dieses Argument wirklich? Ein Blick in die Überholdaten seit Einführung der breiten Autos 2017 zeigt durchschnittlich 6,9 Überholmanöver pro Rennen.
Zwischen 1998 und 2004 - in einer Ära mit deutlich kleineren und agileren Fahrzeugen - lag der Schnitt sogar nur bei 4,2 Überholmanövern pro Rennen. Auch wenn das Überholen seit 2017 messbar schwieriger geworden ist, war es in früheren Zeiten ebenfalls keine Leichtigkeit. Teamtaktiken wären also auch damals bereits möglich gewesen.
2017: Warum manipulierte Ferrari das Rennen nicht?
Auch während der Ära der breiten Autos gab es Gelegenheiten für strategisches Teamplay, das jedoch ungenutzt blieb. 2017 etwa startete Ferrari in Monaco von den Plätzen eins und zwei - mit Kimi Räikkönen vor Sebastian Vettel. Dennoch verzichtete die Scuderia auf die Möglichkeit, Vettel künstlich zu verlangsamen, um Räikkönen einen freien Boxenstopp zu verschaffen - und anschließend die Plätze zu tauschen, wie es Williams 2025 tat.
Stattdessen entwickelte sich ein echtes Rennen. Räikkönen erhielt damals die eigentlich vorteilhaftere Undercut-Strategie. Doch Vettel war auf alten Reifen so schnell unterwegs, dass er seinen Teamkollegen per Overcut überholen konnte - ein fairer Sieg durch reine Pace und clevere Strategie. 2019 gab es eine Mercedes-Doppelführung und auch hier verzichtete das Team auf eine Teamtaktik wie wir sie 2025 gesehen haben, obwohl es möglich gewesen wäre.

© Motorsport Images
Ferrari nutzte Sebastian Vettel 2017 nicht, um Kimi Räikkönen einen gratis Boxenstopp zu ermöglichen Zoom
Der Unterschied zu heute liegt wohl auch im technologischen Fortschritt: Teams können inzwischen strategische Szenarien mit hoher Präzision simulieren. Sie wissen genau, welches Überholdelta erforderlich ist, um bestimmte Strategien aufgehen zu lassen - und wie stark man verlangsamen darf, ohne die Kontrolle zu verlieren. Damit ist das Risiko, auf Teamtaktiken zu setzen, deutlich gesunken.
Delta-Zeit: Eine Lösung gegen taktisches Bummeln?
Eine vorgeschriebene Delta-Zeit - also eine maximal zulässige Rundenzeit - könnte das gezielte Verlangsamen im Rennen unterbinden. Doch wie praktikabel wäre eine solche Maßnahme wirklich?
Am Sonntag war bereits früh im Rennen an der Spitze eine Pace im niedrigen 1:15er-Bereich möglich. Eine maximale Rundenzeit von 1:16 Minuten könnte also als Richtwert dienen. Doch hier beginnt das Problem: Nicht alle Teams sind gleich schnell. Für die Topteams bliebe ein Puffer von rund einer Sekunde - genug, um weiter zu taktieren. Gleichzeitig könnten Teams aus dem hinteren Mittelfeld diese Delta-Zeit womöglich gar nicht erreichen.
Hinzu kommt: Eine Zeitgrenze müsste flexibel sein. Denn je weiter das Rennen fortschreitet und der Benzinstand sinkt, desto größer wird die Differenz zwischen tatsächlicher Pace und möglicher Bummel-Strategie. Eine rollierende Delta-Zeit wäre notwendig - aber in der Praxis schwer umsetzbar.
Formel 1 für 2026 zum Handeln gezwungen
Das Fazit: Eine Delta-Zeit könnte das taktische Verlangsamen erschweren, aber nicht vollständig verhindern. Um das Grundproblem in Monaco wirklich zu lösen, bräuchte es wohl strukturelle Veränderungen - etwa eine Streckenverlängerung mit einer echten Geraden, die Überholen überhaupt erst wieder realistisch macht.
Für die kommende Saison muss sich die FIA gemeinsam mit Rechteinhaber Liberty Media dringend etwas einfallen lassen - denn der Grand Prix von Monaco 2025 hat sprichwörtlich die Büchse der Pandora geöffnet. Die Teams scheinen keinerlei Hemmungen mehr zu haben, ein Rennen gezielt zu manipulieren, was dem Grundgedanken des Racings fundamental widerspricht.
Bleibt eine Reaktion aus, ist davon auszugehen, dass sich der Trend zu aggressiven Teamtaktiken im nächsten Jahr eher verstärken als abschwächen wird. Hoffnung macht zwar das neue Aerodynamik-Reglement, das das Überholen wieder erleichtern könnte - doch ein Blick auf die Überholdaten der Vergangenheit zeigt: Die Autos sind nur ein Teil der Lösung, nicht jedoch das eigentliche Kernproblem.
Eine ausführliche Datenanalyse des Formel-1-Wochenendes in Monaco gibt es übrigens auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Dort beleuchtet Datenexperte Kevin Hermann mithilfe der Strategiesoftware OneTiming von PACETEQ die Details der Teamtaktiken - und stellt zudem die Frage, warum Ferrari bei der Strategie nicht mutiger agiert hat.
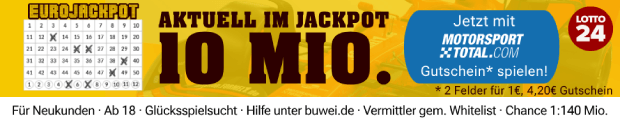


















Neueste Kommentare