Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Der neue BMW-Motor P83 im Detail
Interessante Daten und Fakten zum neuen Formel-1-Motor von BMW, erläutert von Dr. Mario Theissen
(Motorsport-Total.com) - P83 ist die schlichte Bezeichnung für das neue Kraftpaket aus München, mit dem das BMW WilliamsF1 Team in der Formel-1-Weltmeisterschaft 2003 angreift. In der BMW Formel-1-Fabrik entstand ein erneut kraftvollerer und noch kompakterer Dreiliter-Zehnzylinder-Motor, wiederum in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten aus der BMW Serienentwicklung.
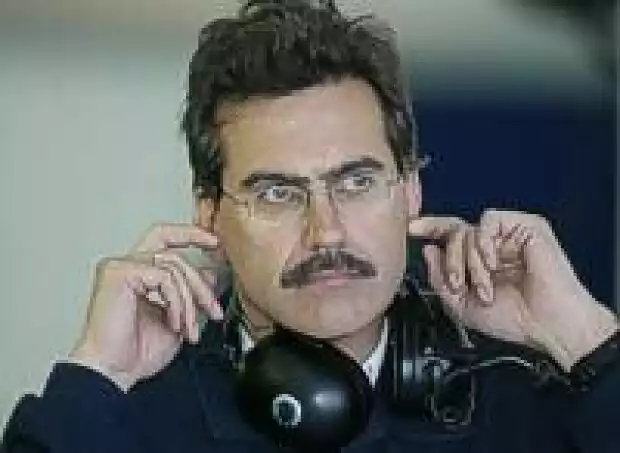
© xpb.cc
Wenn der BMW-Motor bei Testfahrte brüllt, ist Theissen nicht weit entfernt...
BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen: "Mit dem P83 wollen wir die Leistungsdaten gegenüber dem Vorjahr erneut verbessern. Das betrifft sowohl die PS-Zahl als auch die Höchstdrehzahl." Das Triebwerk der Saison 2002, der P82, hatte mit dem Spitzenwert von 19.050 Umdrehungen pro Minute und knapp 900 PS bereits eindrucksvoll Maßstäbe gesetzt.
"Die Schritte", so Theissen weiter, "werden natürlich immer kleiner, je näher wir uns im vorgegebenen Reglement an die Grenze des technisch Machbaren herantasten. Während der Saison wird kontinuierlich weiter entwickelt. Am Ende sollten wir das Potenzial unseres Konzeptes vollständig ausgeschöpft haben. Danach gelten dann durch das ab 2004 geltende Reglement, nach dem nur noch ein Motor pro GP-Wochenende verwendet werden darf, andere Maßgaben."
Neben der weiteren Leistungssteigerung war die Optimierung der Schwerpunktlage ein Konzeptziel des Teams um Heinz Paschen, dem Leiter der BMW F1-Entwicklung. "Die Reduzierung des absoluten Gewichts", erläutert Mario Theissen, "war dabei kein primäres Entwicklungsziel. Entscheidend ist vielmehr die Verteilung. Im oberen Bereich wird mit jedem Gramm gegeizt, am unteren Ende bringt eine weitere Gewichtssenkung nichts. Hier wird bereits heute ein Teil des Fahrzeugballasts platziert." Ein moderner F1-Motor bringt weniger als 100 Kilogramm auf die Waage.
Entwicklungsziel Standfestigkeit
Während Abmessungen, Gewicht und Schwerpunktlage in der Konzept- und Konstruktionsphase fixiert werden, liegt in der weiteren Entwicklungs- und Testphase das Hauptaugenmerk zunächst auf der Standfestigkeit. "In diesem Punkt konnten wir 2002 nicht zufrieden sein", gibt Theissen zu. "Deshalb sind wir dabei, die internen Prozesse von der Entwicklung über die Teilefertigung und die Montage bis hin zum Einsatz an der Rennstrecke nochmals zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass dies Früchte tragen wird. Zuverlässigkeit ist gerade zu Saisonbeginn nahezu ein Garant für WM-Punkte."
Rund 5.000 Einzelteile, davon 1.000 unterschiedliche, müssen auf Herz und Nieren geprüft werden, ehe aus ihnen in durchschnittlich 80 Arbeitsstunden ein Renntriebwerk entsteht. "So entscheidend die Standfestigkeit ist", weiß Theissen, "so wenig ist konservative Technik eine Lösung in der Formel 1. Das physikalisch maximal Umsetzbare ist das Ziel in diesem High-Tech-Sport. Der BMW Motor soll auch 2003 die Benchmark in der F1 setzen. Ausloten kann man den Grenzbereich nur, wenn man bereit ist, auch einmal das Limit zu überschreiten. Wer in der Formel 1 siegen will, der
muss Risiken eingehen. Ganz ohne Motorschäden wird das nicht gehen."
Von der ersten Zeichnung bis zum Roll-out
Im Januar und Februar 2002 war ein Team von 20 der insgesamt 220 bei BMW mit dem F1-Projekt befassten Mitarbeiter mit der Konzeption des P83 beschäftigt. Nach der Konzept- folgte die Konstruktionsphase. Von März bis Juni war die P83-Mannschaft hierfür bereits 50 Mann stark. Parallel begann ab Mai die Teilebeschaffung. Im Juli setzte die Komponentenerprobung
ein. Am 31. Juli knallten in der Fabrik im Münchener Anton-Ditt-Bogen die Sektkorken: Der P83 wurde erstmals auf dem Prüfstand gezündet.
Das frühe Datum ist ebenso Rekord wie der Tag des ersten Einsatzes im Fahrbetrieb. Am 18. September 2002 absolvierte der P83 seinen Roll-out auf dem 'Circuit de Catalunya' bei Barcelona. "Dieser frühe Zeitpunkt und die im Vergleich zum Vorjahr kürzere Wintertestpause", erklärt Mario Theissen, "hat uns eine insgesamt längere Erprobungsphase erlaubt. Das ist ein entscheidender Vorteil für die immer erforderlichen Entwicklungsschleifen, um einmal erkannte Mängel zuverlässig abstellen zu können."
Kontinuierliche Weiterentwicklung von Melbourne bis Suzuka
Während eines Jahres verlassen mehr als 200 F1-Motoren die Fabrik im Münchener Norden. Davon sind nicht alle neu, zum Test und im Training werden auch revidierte, generalüberholte Maschinen eingesetzt. Dabei ist die Entwicklungsphase in der laufenden Saison niemals abgeschlossen, der BMW Motor wird kontinuierlich optimiert. "Diese Entwicklungsschritte sind nicht vorab terminiert", führt Mario Theissen aus, "es geht dabei schwerpunktmäßig zunächst um die Zuverlässigkeit, später um weitere Leistungssteigerung. Wir werden an unserem bewährten Ablauf für die Rennfreigabe festhalten: Jede Motorenkonfiguration wird auf unseren dynamischen Prüfständen über 400 Kilometer im Renntempo betrieben.
Als neuer Standard für höchste Motorbelastung wird nach dem Umbau des Hockenheim-Rings das Streckenprofil von Monza verwendet. Vor der Rennfreigabe können leistungserhöhende Maßnahmen bereits im Qualifying eingesetzt werden. Spezielle Qualifikationsmotoren werden wir auch in Zukunft nicht entwickeln."
Getriebe auf dem Prüfstand
Die Entwicklungs- und Testarbeit von BMW beschränkt sich längst nicht mehr nur auf den Motor. Die Ressourcen des Unternehmens kommen auch dem Getriebe zugute. "Als Automobilhersteller verfügen wir über hochmoderne Simulationsverfahren und Prüfvorrichtungen, wie sie ein Rennteam gar nicht besitzen kann", so Theissen. "Wir unterstützen WilliamsF1 bei der rechnerischen Auslegung von Getriebekomponenten und stellen unsere Prüfstände für Funktions- und Dauerversuche zur Verfügung. Die Möglichkeiten reichen dabei vom Test einzelner Komponenten bis hin zur Rennsimulation mit dem gesamten Antriebsstrang."
Die enge Kooperation zwischen den Motor- und den Fahrzeugkonstrukteuren ist ein Muss. Um den P83 bereits so früh im Jahr 2002 im Fahrzeug erproben zu können, hatte WilliamsF1 ein letztjähriges FW24-Chassis modifiziert und mit dem neuen Getriebe versehen. So konnten Umfänge getestet werden, die auf dem Motorenprüfstand nicht darstellbar sind. Dazu gehören etwa der Kühlkreislauf, die Ölversorgung unter Längs- und Querbeschleunigung sowie die Abstimmung für eine bestmögliche Fahrbarkeit.
Technologie-Transfer vom Modellbau bis zur Fertigung
Alle Kernteile des F1-Motors werden bei BMW entwickelt und gefertigt ? ob Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Kurbel- oder Nockenwelle oder elektronische Steuerung. Theissen: "Der Know-how-Fluss zwischen Motorsport und Serie war bei unserem Formel-1-Projekt von Beginn an Auftrag und Bedingung."
Um den Technologie-Transfer zwischen Sport- und Serienentwicklung zu gewährleisten, wurde die F1-Fabrik am BMW Hauptstandort in München errichtet. Die Ressourcen des BMW Forschungs- und Innovationszentrums, nur einen Steinwurf von der F1-Fabrik entfernt, sind integratives Element. Mit dieser Rückendeckung traute sich BMW von Anfang an, die F1-Motorenelektronik selbst zu entwickeln, anstatt auf die renommierten Spezialisten der Branche zurückzugreifen. Ingenieure, die sich sonst mit der Bordelektronik für die Modelle BMW M3 und M5 befassen, schufen auch die F1-Motorsteuerung. Ihr dabei erworbenes Wissen fließt zurück in die Serie. So verfügt der 7er BMW über Hochleistungsprozessoren, die für die Formel 1 entwickelt und erprobt wurden.
Im BMW M3 schalten und starten wie Schumacher und Montoya
Im Cockpit des BMW M3 stecken andere Verwandte aus der Formel 1. Sie heißen "Sequenzielles M Getriebe ? SMG mit DRIVELOGIC" und "Beschleunigungs-Assistent". Das Antriebskonzept SMG bietet F1-Getriebetechnologie für den Alltagsbetrieb. Dabei werden die Gangwechsel elektrisch per Schaltwippe hinter dem Lenkrad ausgelöst. Wie in der Formel 1 ersetzt ein elektrohydraulisches System den mechanischen Kupplungs- und Schaltvorgang, und der SMG-Bediener darf beim Schalten ebenfalls auf dem Gas bleiben. Der "Beschleunigungs-Assistent" ist eine Automatik, mit der ein optimales Anfahren mit reguliertem Schlupf programmiert werden kann ? vergleichbar mit der Launch Control beim Grand-Prix-Start.
Andere Beispiele des Technologietransfers sind weniger augenfällig
BMW unterhält eine eigene F1-Motorengießerei, die direkt an die Gießerei für Serien-Triebwerke angegliedert ist. So gelangen neue Gusstechniken ohne Umwege in die Serie. Mit dem gleichen Sandgussverfahren, mit dem der Formel-1-V10 entsteht, werden Ölwannen für die Modelle M3, M5 und Z8 sowie die Sauganlage für den Achtzylinder-Dieselmotor gegossen.
Entscheidende Impulse kommen zudem aus der Materialforschung, die für das Formel-1-Engagement betrieben wird. Umgekehrt profitiert die F1-Mannschaft von Know-How und Anlagen im Bereich Rapid Prototyping. Eine eigene Formel-1-Teilefertigung, wie die Gießerei an ihr Pendant für Serienfahrzeuge angebunden, dient ebenfalls der simultanen Vernetzung von Konstruktion und Fertigung für den Rennsport und die Serie. Theissen: "Durch die enormen Anforderungen der Formel-1-Entwicklung nutzen und verbessern wir bei BMW unser hauseigenes Spezialwissen und können es so in die Serie transferieren."
Zukunftsmusik ? der Motor für 2004
Die Ressourcen und Labors der verschiedenen BMW Abteilungen in München sind längst mit Zielen jenseits von 2003 befasst. Schon während der P83 im Herbst 2002 seine ersten Testfahrten absolvierte, wurde in München mit der Konzeption des Motors für die Saison 2004 begonnen. Nach dem dann gültigen Reglement darf am gesamten Grand-Prix-Wochenende nur noch ein Motor eingesetzt werden. Dadurch erhöht sich die Anforderung an die Laufzeit von bisher 400 auf dann 800 Kilometer. "Die Entwicklungsarbeit dafür ist durchaus eine neue Herausforderung", betont BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen, "und damit eine neue Chance, der Beste zu sein.
Technische Daten BMW P83
Bauart: 10-Zylinder-V-Saugmotor
Bankwinkel: 90 Grad
Hubraum: 2.998 ccm
Ventile: vier pro Zylinder
Ventiltrieb: pneumatisch
Motorblock: Aluminium
Zylinderkopf: Aluminium
Kurbelwelle: Stahl
Ölsystem: Trockensumpfschmierung
Motorsteuerung: BMW















