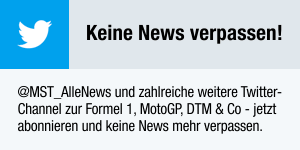Die Analyse der geplanten Budgetobergrenze
In der Formel 1 wird über die Einführung einer Budgetobergrenze nachgedacht - Max Mosley und Marc Surer analysieren Vor- und Nachteile
(Motorsport-Total.com) - Seit einigen Wochen gibt es in der ewigen Kostendiskussion in der Formel 1 einen neuen Aspekt, denn der schon vor einigen Jahren erstmals aufgekommene Vorschlag einer einheitlichen Budgetobergrenze wird nun ernsthaft in Betracht gezogen. Sollte alles nach Plan laufen, könnte diese schon 2009 eingeführt werden.

© xpb.cc
Pro Jahr geben die Teams zwei bis drei Milliarden Euro für die Formel 1 aus
Die Teamchefs können sich für diese Idee erwärmen, seit das World Council der FIA im Dezember andere Maßnahmen zur Kostensenkung beschlossen hat. Dabei handelt es sich konkret um das Verbot eines zweiten Windkanals, um eine Maximalzahl der CFD-Mitarbeiter und so weiter. Kürzungen in diesen Bereichen sind freilich den Vorständen der Automobilhersteller schwer unterzujubeln, weil gerade dafür in den vergangenen Jahren riesige Summen investiert wurden.#w1#
Purnell leitet die FIA-Kommission
Diese würden durch die geplanten Einschnitte ins Reglement mit einem Schlag hinfällig, also haben sich die Teamchefs überlegt, wie man Kosten einsparen könnte, ohne dass sie ihren Vorgesetzten erklären müssen, warum alle Investitionen der vergangenen Jahre über Nacht nichtig sind. Die FIA hat angebissen und daraufhin eine von Tony Purnell geführte Kommission ins Leben gerufen, die nun Vorschläge für eine Budgetobergrenze ausarbeiten soll.
Dass der Beschluss, die zweiten Windkanäle zu verbieten, eine Schnapsidee ist, findet auch Marc Surer: "Damit würde man die Großen vor den Kopf stoßen, aber auch die Kleinen. Force India hat ja jetzt auch drei Windkanäle. Somit würde man selbst dieses Team daran hindern, dass sie aufschließen. Denn wenn man aufholen muss, braucht man den Windkanal, weil man ja nicht mehr als die anderen Teams auf der Strecke testen darf", analysiert der 'Motorsport-Total.com'-Experte.
Klar ist aber auch, dass die Kosten sinken müssen, schließlich hat David Richards sein geplantes Prodrive-Projekt gerade erst auf Eis gelegt, weil er sich die Formel 1 momentan nicht leisten kann. Surer: "Es kann nicht sein, dass man nur noch wettbewerbsfähig ist, wenn man 300 oder 400 Millionen hat. Man hat sich an diese Summen gewöhnt, aber das muss ja irgendwer bezahlen." Die Tabakindustrie kann das wegen des Tabakwerbeverbots ja nicht mehr tun.
Wie lange bleiben die neuen Sponsoren?
Zwar gibt es seit einigen Jahren Tendenzen, dass sich neue Branchen für die Formel 1 interessieren, weil diese "rauchfrei" geworden ist und damit ein saubereres Image erlangt hat, aber dass die vielen Versicherungs- und Elektronikkonzerne ewig an Bord bleiben werden, ist ja auch nicht gesagt. Also erscheint es sinnvoll, die Formel 1 finanziell abzuspecken, damit sie nicht permanent auf Gelder von außen angewiesen ist.
Und dann sind da ja noch die in erster Linie profitorientierten Automobilhersteller, die auf ihr Geld schauen müssen: "Ihre Aktien sind seit Sommer im Sinkflug, was bedeutet, dass sie weniger Profit machen werden", erklärt FIA-Präsident Max Mosley. "Wenn das passiert, dann ist es eine schnelle Möglichkeit, 100 oder 200 Millionen US-Dollar einzusparen, indem das Formel-1-Team zugesperrt wird. Und das wissen die Teams auch."
"Also realisieren die Teams langsam, dass eine Budgetobergrenze gar nicht so unsinnig wäre, wie sie auf den ersten Blick aussehen mag. Gegen nur einen Motor pro Rennwochenende haben sich am Anfang auch ein, zwei Teamchefs so vehement wie nie zuvor gegen etwas gewehrt, aber wenn man ihnen jetzt sagen würde, dass wir wieder drei Motoren pro Wochenende verwenden wollen, dann würden sie es sicher nicht mehr machen", so der Brite.
Surer fordert ein Kontrollorgan

© Motorsport-Total.com
Unser Formel-1-Experte Marc Surer im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' Zoom
Aber die Budgetobergrenze wird in den meisten Fällen nicht leicht zu überwachen sein, weiß Ex-Formel-1-Pilot Surer: "Die Kontrollierbarkeit ist das Hauptproblem." Denn: "Wenn die Teams das Geld haben, geben sie es auch aus. Wenn man ihnen die Testfahrten verbieten, investieren sie halt in Prüfstände. Also kommt man auf die Idee, die Ausgaben an sich zu begrenzen. Es muss aber ein Kontrollorgan geben durch die FIA."
Der Schweizer hat diesbezüglich auch schon eine Idee: "In der Technik gibt es die Möglichkeit, bei der FIA anzufragen, ob man etwas darf oder nicht. Und die anderen Teams achten ja auch drauf. Die fragen dann an: Dieses und jenes Team macht das so und so - ist das eigentlich erlaubt?" Genau so eine Variante wird von Mosley schon angedacht: Die Teams dürfen bei der FIA anfragen, was erlaubt ist und was nicht, und anschließend wird dieser spezielle Fall für alle transparent aufgeklärt.
Auf diese Weise könnte man nach und nach die Grauzonen der Budgetobergrenze eliminieren, denn dass das System von Anfang an perfekt funktionieren wird, ist eine Illusion. Das liegt einfach in der Natur der Sache, weil die Formel-1-Teams immer versuchen, die Limits auszuloten. Außerdem gibt es ganz banale Beispiele, die man im Vorfeld definieren muss: Ist es beispielsweise ein Budgetposten, wenn ein Teamchef einen neuen Dienstwagen bekommt?
Externe Firmen als Grauzone?
Anderes Beispiel: Ein Team könnte einen Deal mit einer externen Firma wie Boeing eingehen, um dort im Austausch gegen Werbeflächen Forschungsarbeiten erledigen zu lassen. Außerdem gibt es einige Teams, die zwei bis drei Windkanäle haben, andere aber nur einen. Was also, wenn jemand einen zweiten Windkanal um mehr als 100 Millionen Euro bauen lässt? Dann bleibt kaum noch Geld für den Rennbetrieb übrig...
Es gibt aber schon Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte, nämlich dass nicht finanzielle Werte nach einem einheitlichen Schlüssel in finanzielle Maßstäbe umgerechnet werden. Hat ein Team wie Honda beispielsweise einen zweiten Windkanal, dann schrumpft das erlaubte Jahresbudget um einen Betrag X. Oder: Lässt jemand ein mechanisches Bauteil extern anfertigen, dann werden die Kosten dafür ebenfalls vom Gesamtbudget abgezogen.
Wie werden Kundenteams gehandhabt?
Diese Frage stellt sich natürlich auch bei Kundenteams wie Super Aguri oder Toro Rosso, von denen die A-Teams klarerweise profitieren, indem sie doppelte Informationen vorliegen haben. Mosley entkräftet das aber: "Sagen wir einmal, Honda bekommt gewisse Informationen von Super Aguri. Unsere Budgetfahnder werden sagen: 'Ihr bekommt da Infos von Super Aguri und wir glauben, dass der Gegenwert davon der Betrag X ist.'"
Nur: Was passiert, wenn ein Team heimlich auf Kosten des Mutterkonzerns (damit die Zahlen nicht im Formel-1-Budget aufscheinen) einen anderen Windkanal verwendet - unter strengster Geheimhaltung? "Es wird irgendwo durchsickern, dass da was läuft", winkt Surer ab, und Mosley ergänzt zustimmend: "Ich glaube, es wäre schwierig, selbst einen Windkanal in den argentinischen Bergen geheim zu halten..."
Auf jeden Fall muss es ein Kontrollorgan geben: "Im extremsten Fall werden wir für zehn Teams 30 Leute einsetzen", schlägt Mosley vor. "Man würde sie zu den Teams schicken und rotieren lassen, damit sie nicht sesshaft werden und Beziehungen aufbauen. Diese Leute müssten alles genau inspizieren. Außerdem werden wir vielleicht eine Kommission mit unabhängigen Finanzexperten ins Leben rufen."
Teams müssen Spione selbst zahlen

© xpb.cc
In die Fabriken (hier jene von Honda) sollen Spione eingeschleust werden Zoom
Natürlich werden die Teams nicht in Jubelstürme ausbrechen, wenn sie hören, dass Spione in die Fabriken eingeschleust werden, aber Mosley erwartet dennoch keinen Widerstand: "Wenn jemand im Moment 200 Millionen Euro ausgibt und das auf 100 Millionen Euro reduziert werden könnte, dann wären die zwei Millionen an Zusatzkosten für diese Abteilung nicht viel Geld." Ferrari und Co. müssten diese Leute nämlich aus der eigenen Tasche zahlen.
"Die erste Reaktion der Teamchefs wird sein, dass sie sich aufregen, weil jemand in ihr Revier eindringt und weil sie nicht wollen, dass sich jemand in der Fabrik aufhält, aber wenn sie darüber nachdenken, dann werden sie sich über die Budgetobergrenze freuen, weil sie weniger ausgeben müssen und somit im Business bleiben. Der ehrliche Teamchef will außerdem nicht schummeln, sondern nur sicher sein, dass sonst niemand schummelt", argumentiert der FIA-Präsident.
Aber die große Frage ist, bei welchem Betrag die Budgetobergrenze überhaupt angesetzt werden soll. Motorenbudgets und Fahrergehälter, das steht bereits fest, werden sowieso gesondert betrachtet. Die Summe, die für den Rest im Raum steht, ist 150 Millionen Euro. Mosley: "Ich möchte wieder da hinkommen, wo die Budgets Anfang der 1990er-Jahre waren. Alle Teams zusammen geben zwischen zwei und drei Milliarden Euro aus im Moment. Das sollten wir halbieren, sonst wäre ich enttäuscht."
Gehaltsobergrenzen kein Thema
Ein Ansatz, wie man das erreichen könnte, ist abseits der Ausgaben für die Technik natürlich auch der Gehaltsaspekt. Alleine Kimi Räikkönen verdient bei Ferrari mehr als 20 Millionen Euro - alle Fahrer zusammen dürften einen Kostenpunkt von etwa 150 Millionen Euro ausmachen. Dazu kommen dann noch die teilweise astronomischen Gagen für Ingenieure, von denen viele ebenfalls siebenstellige Summen kassieren.
Aber eine Gehaltsobergrenze, wie sie von einigen angedacht (und inzwischen schon wieder verworfen) wurde, erscheint unsinnig: "Was soll das? Wir leben in der freien Wirtschaft. Wenn ich Hamilton haben kann oder Ross Brawn, dann zahle ich fast jeden Preis als Teamchef", wundert sich Surer über derartige Überlegungen. "Das ist freie Marktwirtschaft, das finde ich völlig normal. Da eine Grenze festzusetzen, halte ich für nicht denkbar."
Wie sehr die Kosten in der Formel 1 explodiert sind, beweist allerdings der Vergleich der Surer-Gage in den 1980er-Jahren mit jener eines aktuellen Mittelfeldfahrers: Unser Experte hat damals gerade mal 500.000 US-Dollar verdient - nur in etwa ein Zehntel dessen, was er geschätzt heute wert wäre. Dass etwas unternommen werden muss, steht also außer Frage. Ob die Budgetobergrenze die richtige Lösung ist, wird sich zeigen...