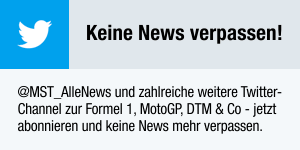Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Paydriver: Von Träumen und gescheiterten Existenzen
Heikki Kovalainen & Co. klagen an: Warum der Trend zu Paydrivern in der Formel 1 und GP2 nicht nur den Motorsport, sondern auch Existenzen kaputt macht
(Motorsport-Total.com) - Nico Hülkenberg hatte dem Williams-Team gerade die erste Pole-Position nach einer über fünfjährigen Durststrecke beschert, da wusste Teammanager Adam Parr schon: Ich muss den talentierten Deutschen vor die Tür setzen, weil im Jahr darauf, 2011, Pastor Maldonado mit 35 Millionen Euro zu uns kommen wird. Und keine Pole-Position der Formel-1-Welt ist 35 Millionen Euro wert. Oder, anders ausgedrückt: Für 35 Millionen Euro Schmerzensgeld darf ein Fahrer viel Mist bauen...

© xpbimages.com
Kovalainen & Fernandes: "Sorry, Heikki, aber ich habe kein Gratis-Cockpit für dich" Zoom
35 Millionen Nadelstiche in Hülkenbergs verletzlicher Haut. "Es ist bitter, es tut weh", sagte er damals. "Natürlich ist diese Paydriver-Problematik für mich sehr unschön, denn mich hat es voll erwischt." Obwohl eines der größten Nachwuchstalente im Formelsport, stand er plötzlich ohne Formel-1-Cockpit da und musste sich mit der Reservistenrolle bei Force India zufrieden geben. Es hatte auch ein bisschen mit Glück zu tun, dass sich seine Karriere trotzdem so entwickelt hat.
Heikki Kovalainen wehrt sich auch bis heute, für einen Stammplatz in der Formel 1 als Bittsteller bei Sponsoren aufzutreten: "Diese Kerle kommen und kaufen sich ihre Cockpits. Ich versuche, mir meinen Platz auf andere Art und Weise zu verdienen", knurrt er. "Ich hatte meine Chance bei McLaren. Es hat nicht geklappt und das ist schwierig zu verkraften. Vielleicht habe ich nicht das Maximum herausgeholt. Aber es kann wieder klappen."
Es wäre ihm zu wünschen, aber die gegenwärtige Realität ist eine andere: Obwohl Caterham-Eigentümer Tony Fernandes ganz genau weiß, dass Kovalainen einen Giedo van der Garde oder auch Charles Pic locker in die Tasche stecken würde, gibt er ihm kein Stammcockpit. Zumindest kann sich Kovalainen in Schuss halten, weil das Team wenigstens in Freien Trainings auf seine Expertise und Erfahrung als Entwicklungsfahrer zurückgreifen möchte. Das geht auch ohne Sponsoren.
Rennfahrer ohne Lebensgrundlage
Aber Kovalainen, im Jahr 2008 sogar noch Grand-Prix-Sieger in der Formel 1, hadert mit seinem Schicksal: "Für mich funktioniert der Sport nicht richtig, wenn man Geld damit verliert, seinen Job zu machen. So kann man nicht überleben. Damit habe ich kein Problem: Wenn Leute die Möglichkeit dazu haben, ist das okay, aber ich glaube, andere Fähigkeiten zu besitzen. Hoffentlich sind das diejenigen, die am Ende den Ausschlag geben."
Momentan entscheiden (indirekt) mächtige Männer wie Hugo Chavez darüber, wer Formel 1 fährt. Der inzwischen verstorbene Präsident von Venezuela segnete einst den Plan ab, dass sein Land bis zu 200 Millionen Euro in die Hand nehmen soll, um Pastor Maldonado fünf Jahre lang bei einem Grand-Prix-Team zu platzieren. Adam Parr zog diesen Jahrhundert-Deal für Williams an Land - sehr zum Leidwesen von Hülkenberg.
Aber es sind nicht immer Millionenentscheidungen von Staatspräsidenten, die eine Formel-1-Karriere ermöglichen oder verhindern. Viele potenzielle Champions der Zukunft werden schon im Kartsport ausgesiebt, weil sich ihr Vater keine neuen Reifen leisten kann oder kein neuer Motor mehr drin ist. Selbst der gelernte Zimmermann Norbert Vettel tuckerte einst mit dem kleinen Sebastian im Wohnmobil durch Deutschland und setzte damit in Wahrheit alles auf eine Karte.
Ganz ähnlich hat die Karriere von Valtteri Bottas begonnen: "Die erste Saison", erinnert er sich im Interview mit 'Motorsport-Total.com', "hat vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro verschlungen. Wir hatten ein gebrauchtes Kart und brauchten eigentlich nur Öl und Sprit. Danach wurde es aber immer mehr." Denn mit dem Erfolg kommt auch die Notwendigkeit, an weiter entfernten, professionelleren und damit auch teureren Rennen teilzunehmen.
Bottas' Vater mit eigenem Geld beteiligt
"Meine letzte Saison im Kart, in der ich hauptsächlich außerhalb von Finnland gefahren bin, kostete mehr als 50.000 Euro", kalkuliert der heutige Williams-Rookie. "Diese Summe wurde nicht komplett von Sponsoren aufgestellt. Mein Vater steuerte stets eigenes Geld oder Geld aus seiner Reinigungsfirma bei. Den Großteil haben aber immer Sponsoren dazugegeben. So war es bis 2008, als Mika Häkkinen und Toto Wolff angefangen haben, mir zu helfen."
Aber selbst wenn Sponsoren Geld in ein Team pumpen und auf diese Weise finanzieren, dass ihr Schützling eine weitere Saison Rennfahren kann, stellt sich immer noch die Frage, wovon ein junger Rennfahrer eigentlich leben soll. Denn selbst wenn nicht alle Sponsorengelder direkt ans Team überwiesen werden, müssen ja auch noch Reise- und Lebenserhaltungskosten bezahlt werden - meistens nicht nur die eigenen, sondern auch die des begleitenden Umfelds.
Bottas hatte diesbezüglich Glück und kam zumindest irgendwie über die Runden: "Ich hatte ein bisschen Sponsoring aus meinem Heimatort. Dort wurde ich stets unterstützt. Da kriegst du ein bisschen was", erklärt er. "In der Formel Renault oder in der Formel 3 kannst du aber nichts sparen. Sobald du etwas Geld hast, kaufst du dir etwas zu essen. Dann ist das Geld auch schon wieder weg. Bis zur Formel 1 verdienst du eigentlich nichts."
Vom Renncockpit ins Sozialhilfeprogramm
Das ist die Kehrseite des vermeintlich so glamourösen Motorsports: Geht die Karriereplanung nicht so auf wie erhofft, steht man möglicherweise vor einem Schuldenberg, im schlimmsten Fall auch noch ohne Ausbildung, um in ein anderes Leben zu starten und sich eine Existenz aufzubauen. Der beste Fall ist, außerhalb der Formel 1 bezahlte Jobs zu finden, etwa als Werksfahrer für einen Hersteller, als Safety-Car-Pilot oder als Instruktor.
Aber die wenigen Rennfahrer, die sich mit dem Rennfahren ihren Lebensunterhalt finanzieren können, sind die Ausnahme von der Regel. Oftmals endet der Traum von der Formel 1 als gescheiterte Existenz in Sozialhilfeprogrammen. Und diese Entwicklung beginnt nicht erst in der GP2, sondern schon viel früher. Die 45.000 Euro für eine Saison im nationalen Kartsport können eine mäßig verdienende deutsche Familie schon an den Rand des Ruins treiben.
Vietoris sieht Problem schon in der GP2
Umso bitterer, wenn Paydriver jungen Talenten bereits in Nachwuchsformeln die Plätze wegschnappen: "Ich habe die Rennen fast alle gesehen: Die Fahrer, die viel Geld mitbringen, kommen zum Zuge - und die richtigen Talente können sich dann nicht mehr durchsetzen", kritisiert etwa Ex-GP2-Pilot Christian Vietoris, heute Topfahrer in der DTM. "Das ist eine Entwicklung, die im Nachwuchsbereich bedenklich ist. Es wird schwierig, die richtige Serie zu finden und sich in Szene zu setzen."

© Hust/MST
DTM-Fahrer Christian Vietoris im Gespräch mit Chefredakteur Christian Nimmervoll Zoom
"Das fing schon zu meinen Zeiten an", erinnert er sich. "Die GP2 wurde teurer und teurer, jetzt fahren sie sogar noch in Übersee. Und was kann man schon an Erfahrung sammeln? Es gibt 30 Minuten Freies Training, dann ein Qualifying und zwei Rennen - und das Wochenende ist vorbei. Da kann man als Fahrer nicht viel lernen. Wichtig ist, lange im Auto zu sitzen und viele Kilometer zu fahren. Das ist in der GP2 nicht der Fall."
Die Wurzel allen Übels sind die hohen Kosten, die eben nicht erst in der Formel 1, sondern schon im Unterbau anfangen. Nicht nur Peter Sauber muss sich gut überlegen, wie er das nächste Jahr überleben soll, und deswegen einen zahlungskräftigen Fahrer an Bord holen, sondern auch GP2-Teamchef X oder Formel-3-Teamchef Y muss ohne zusätzliches Geld zusperren. Und dann heißt es meistens: Lieber einen Paydriver im Auto als gar nicht mehr fahren...